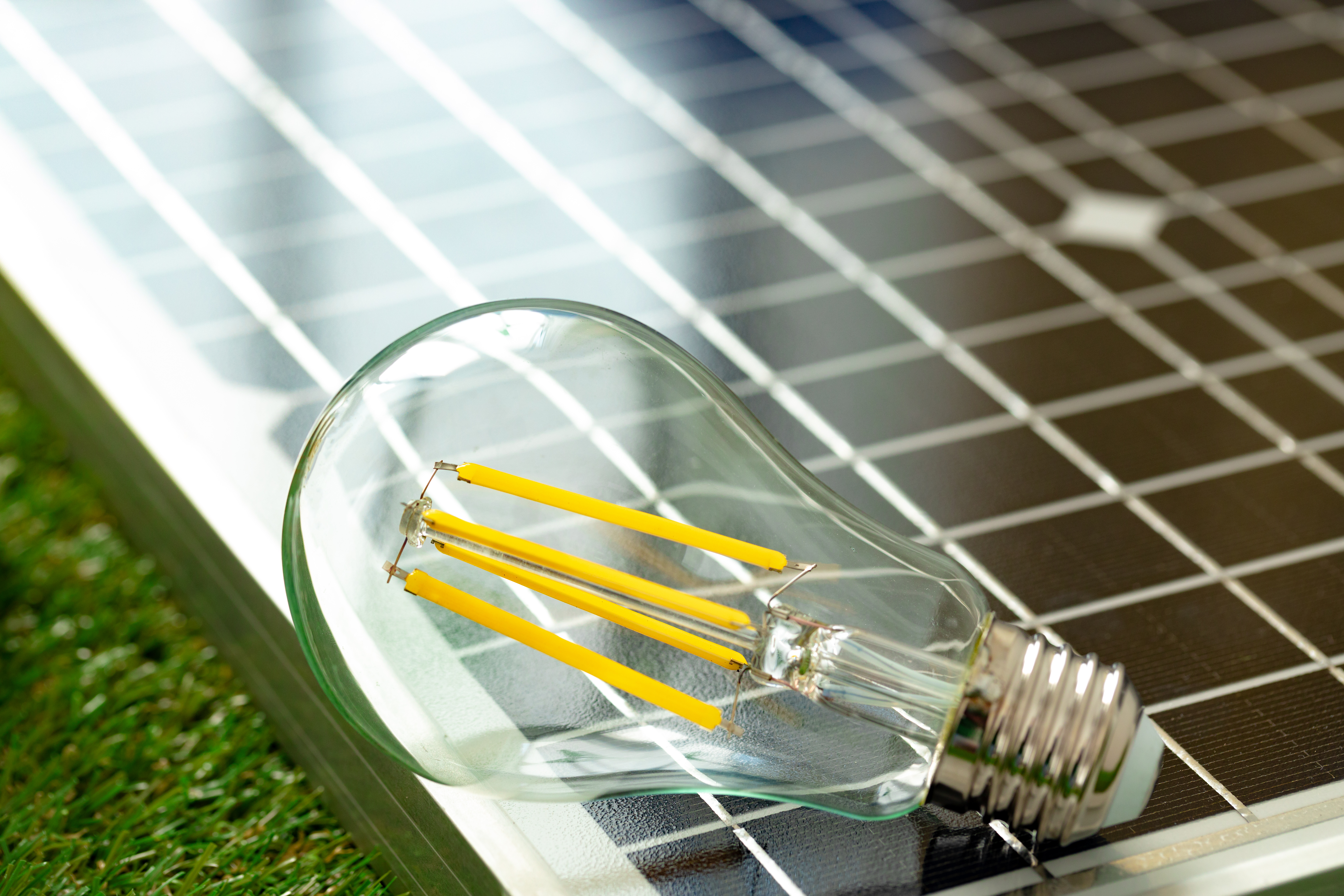Balkonkraftwerke sind kleine Solaranlagen, die man einfach an eine Steckdose anschließen kann, um eigenen Strom zu erzeugen. Sie sind vor allem für Mieter oder Eigentümer mit wenig Platz geeignet, die ihre Stromkosten senken und die Umwelt schonen wollen. In diesem Blogpost beantworten wir einige häufige Fragen zu Balkonkraftwerken und geben Ihnen Tipps, worauf Sie achten sollten.
Was ist ein Balkonkraftwerk?
Ein Balkonkraftwerk besteht aus einem oder mehreren Photovoltaik-Modulen, die Sonnenlicht in elektrischen Strom umwandeln. Die Module werden meist am Balkongeländer, an der Fassade oder auf dem Garagendach befestigt. Ein integrierter Wechselrichter wandelt den erzeugten Gleichstrom in Wechselstrom um, der über einen Stromnetz-Stecker an eine normale Steckdose angeschlossen wird. Der Strom wird dann ins Hausnetz eingespeist und kann von allen Verbrauchern genutzt werden.
Wie viel Strom kann ein Balkonkraftwerk erzeugen?
Die Leistung eines Balkonkraftwerks hängt von mehreren Faktoren ab, wie zum Beispiel der Größe und Qualität der Module, der Ausrichtung und Neigung zur Sonne, dem Standort und dem Wetter. In Deutschland sind aus Sicherheitsgründen nur Balkonkraftwerke mit maximal 600 Watt erlaubt. Das bedeutet aber nicht, dass sie immer 600 Watt erzeugen können. Die tatsächliche Leistung schwankt je nach Sonneneinstrahlung und kann auch deutlich niedriger sein.
Um eine optimale Ausbeute zu erreichen, sollte man die Module möglichst nach Süden ausrichten und einen Winkel von etwa 30 Grad einstellen. Außerdem sollte man darauf achten, dass keine Schatten oder Verschmutzungen die Module beeinträchtigen.
Wie viel Geld kann man mit einem Balkonkraftwerk sparen?
Mit einem Balkonkraftwerk kann man einen Teil seines eigenen Strombedarfs decken und somit weniger Strom vom Netz beziehen müssen. Dadurch spart man Geld bei der Stromrechnung und reduziert seinen CO2-Fußabdruck.
Die Höhe der Einsparung hängt davon ab, wie viel Strom das Balkonkraftwerk erzeugt und wie viel davon selbst verbraucht wird. Je höher der Eigenverbrauch ist, desto mehr lohnt sich das Balkonkraftwerk. Denn für den überschüssigen Strom, der ins öffentliche Netz eingespeist wird, gibt es in Deutschland keine Vergütung.
Um den Eigenverbrauch zu erhöhen, sollte man versuchen, möglichst viele Verbraucher tagsüber laufen zu lassen, wenn das Balkonkraftwerk am meisten Strom produziert. Dazu gehören zum Beispiel Kühlschrank, Gefrierschrank, Waschmaschine oder Geschirrspüler.
Eine genaue Berechnung der Einsparung ist nicht einfach, da sie von vielen individuellen Faktoren abhängt. Eine grobe Faustregel ist aber: Ein 600-Watt-Balkonkraftwerk spart im Jahr etwa 100 bis 150 Euro bei einem durchschnittlichen Haushaltsstrompreis von 30 Cent pro Kilowattstunde.
Wie viel kostet ein Balkonkraftwerk?
Die Kosten für ein Balkonkraftwerk variieren je nach Anbieter und Modell. Im Durchschnitt muss man mit etwa 500 bis 1200 Euro rechnen für ein komplettes Set aus Modulen, Wechselrichter und Montagematerial.
Dazu kommen eventuell noch Kosten für eine Anmeldung beim Netzbetreiber oder eine Installation durch einen Fachmann. Außerdem sollte man regelmäßig die Module reinigen und warten lassen.
In vielen Bundesländern oder Kommunen gibt es Förderungen für Balkonkraftwerke in Form von Zuschüssen oder zinsgünstigen Krediten. Diese können die Anschaffungskosten deutlich senken oder sogar komplett decken.
Welche rechtlichen Voraussetzungen gibt es für ein Balkonkraftwerk?
Zunächst muss man die Zustimmung des Vermieters oder der Eigentümergemeinschaft einholen, wenn man ein Balkonkraftwerk installieren möchte. Dabei sollte man darauf achten, dass das Balkonkraftwerk keine baulichen Veränderungen am Gebäude verursacht und keine Gefahr für andere Bewohner oder Passanten darstellt.
Außerdem muss man das Balkonkraftwerk bei dem zuständigen Netzbetreiber anmelden und einen geeigneten Wechselrichter verwenden. Der Wechselrichter ist das Gerät, das den Gleichstrom aus dem Balkonkraftwerk in Wechselstrom umwandelt, der ins Stromnetz eingespeist werden kann. Der Wechselrichter muss den technischen Anforderungen des Netzbetreibers entsprechen und über eine Schutzeinrichtung verfügen, die das Balkonkraftwerk bei einem Stromausfall automatisch vom Netz trennt.
Schließlich muss man sich über die steuerlichen und finanziellen Aspekte eines Balkonkraftwerks informieren. Je nachdem, wie viel Strom man mit dem Balkonkraftwerk erzeugt und wie viel davon ins Netz eingespeist wird, kann man von einer Vergütung profitieren oder Steuern zahlen müssen. Es empfiehlt sich daher, einen Fachmann zu konsultieren oder sich bei der Verbraucherzentrale beraten zu lassen.
Vor- und Nachteile von Balkonkraftwerken?
Ein Balkonkraftwerk ist eine kleine Solaranlage, die auf dem Balkon oder an der Fassade montiert wird und Strom über eine Steckdose einspeist. Damit können Mieter oder Eigentümer ihren eigenen Ökostrom erzeugen und ihre Energiekosten senken. Doch welche Vor- und Nachteile hat ein Balkonkraftwerk? Hier sind einige Punkte, die man beachten sollte.
Vorteile:
- Ein Balkonkraftwerk ist eine einfache und günstige Möglichkeit, an der Energiewende teilzunehmen. Für rund 500-800 Euro bekommt man eine Komplettanlage mit einem Solarmodul, einem Wechselrichter, einem Kabel und einem Gestell oder einer Befestigung. Damit kann man bis zu 10 Prozent seines jährlichen Stromverbrauchs decken und sich unabhängiger vom Stromnetz machen.
- Ein Balkonkraftwerk ist umweltfreundlich und nachhaltig. Mit Sonnenenergie produziert man sauberen Strom ohne CO2-Emissionen oder andere Schadstoffe. Damit leistet man einen Beitrag zum Klimaschutz und zur Reduzierung der fossilen Rohstoffe.
- Ein Balkonkraftwerk ist einfach zu installieren und zu betreiben. Man braucht nur einen geeigneten Platz auf dem Balkon oder an der Fassade mit direkter Sonneneinstrahlung und eine Steckdose in der Nähe. Die Anmeldung beim Netzbetreiber erfolgt im vereinfachten Verfahren und die Wartung ist minimal.
- Ein Balkonkraftwerk ist mobil und flexibel. Man kann es bei einem Umzug einfach mitnehmen oder an einem anderen Ort montieren. Auch die Größe und Leistung kann man individuell anpassen, indem man mehrere Module miteinander verbindet oder austauscht.
- Ein Balkonkraftwerk ist auch für Mieter geeignet. Man braucht keine Genehmigung vom Vermieter oder von der Eigentümergemeinschaft, solange das Modul nicht fest am Gebäude angebracht wird. Man muss nur den Netzbetreiber informieren und einen Zweirichtungszähler einbauen lassen.
Nachteile:
- Ein Balkonkraftwerk hat eine lange Amortisationszeit. Je nach den Bedingungen vor Ort kann es mehrere Jahre dauern, bis sich die Investitionskosten amortisiert haben. Das hängt davon ab, wie viel Strom man selbst verbrauchen kann und wie hoch der Strompreis ist. Außerdem muss man eventuell zusätzliche Kosten für den Zweirichtungszähler oder das Zubehör berücksichtigen.
- Ein Balkonkraftwerk unterliegt rechtlichen Vorgaben und Normen, die oft verwirrend sind. Man muss sicherstellen, dass das Modul zertifiziert ist und den technischen Anforderungen entspricht. Außerdem muss man sich an die geltenden Vorschriften für den Netzanschluss halten und gegebenenfalls Steuern oder Abgaben zahlen.
- Ein Balkonkraftwerk bekommt keine Vergütung für die Netzeinspeisung. Der überschüssige Strom, den man nicht selbst verbrauchen kann, wird ins Netz eingespeist, aber nicht vergütet. Das bedeutet, dass man keinen finanziellen Anreiz hat, möglichst viel Strom zu produzieren.
- Ein Balkonkraftwerk ist von der Sonneneinstrahlung abhängig. Die Stromerzeugung variiert je nach Jahreszeit, Tageszeit und Wetterbedingungen. Das bedeutet, dass man nicht immer genug Strom hat, um seinen Bedarf zu decken. Deshalb braucht man immer noch einen Anschluss ans öffentliche Netz.